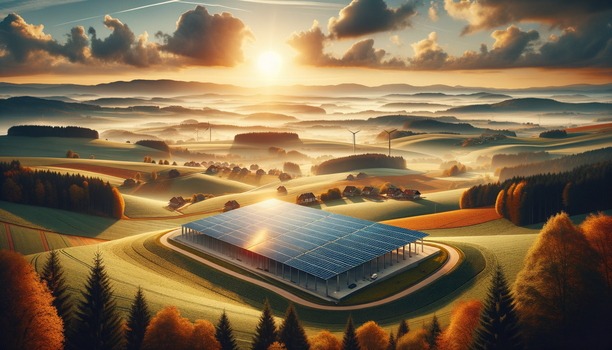
Transformation Energiesystem Leibniz Universität Hannover: Neuer Forschungsschwerpunkt Energieforschung
Letztes Update: 25. August 2024
Die Leibniz Universität Hannover etabliert einen neuen Forschungsschwerpunkt 'Energieforschung', der Photovoltaik, Energiespeicher, Netzintegration und Simulation verknüpft. Im Artikel erfahren sie, welche Projekte, Testfelder und Kooperationen geplant sind und welche Impulse das für Praxis und Politik liefert.
Neuer Forschungsschwerpunkt Energieforschung an der Leibniz Universität Hannover
Innovative Lösungen für die Transformation des Energiesystems
Wie kann der Übergang zu einem klimaneutralen Energiesystem gelingen? Wie heizen wir in Zukunft, welche Antriebstechnologien benutzen wir zur Fortbewegung, und mit welchen Energieträgern versorgen wir unsere Industrie? Können wir unser Energiesystem dabei stabil und kostengünstig halten, und wie reduzieren wir die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten? An der Leibniz Universität Hannover (LUH) arbeiten und forschen etwa 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über alle Fakultäten hinweg gemeinsam an diesen Themen. Die Energieforschung wird jetzt sechster Forschungsschwerpunkt an der LUH. Er ergänzt die fünf bereits etablierten Forschungsschwerpunkte Biomedizinforschung und -technik, Optische Technologien, Produktionstechnik, Quantenoptik und Gravitationsphysik sowie Wissenschaftsreflexion.
Forschungsschwerpunkte und systemische Zusammenhänge
Gegenstand der Arbeiten im neuen Forschungsschwerpunkt sind dabei die Weiterentwicklung von ausgewählten Technologien zur Bereitstellung, Speicherung, zum Transport und zur Nutzung von Energie sowie die Betrachtung von systemischen Zusammenhängen und Wechselwirkungen mit der Umwelt und der Gesellschaft. Die LUH verfügt über eine lange Historie im Bereich der Energieforschung, beispielsweise in der Kraftwerkstechnik, der elektrischen Energietechnik sowie in der Wind- und Solarenergie. Diese Kompetenzen wurden in den letzten Jahren durch Neuberufungen gezielt verstärkt. Die LUH hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Forschungskompetenz die Transformation des Energiesystems auf nachhaltige Energieträger zu unterstützen.
Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE)
Bereits 2013 wurde das Leibniz Forschungszentrum Energie 2050 (LiFE) gegründet, um die Forschungsaktivitäten in Forschungslinien zu bündeln, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen sowie Kompetenzpartner für Gesellschaft und Industrie zu sein. „Ich freue mich sehr, dass unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserem nun offiziellen neuen Forschungsschwerpunkt an diesen gesellschaftlich hochrelevanten Themen arbeiten. Herausragende Forschung wird hier auf vorbildliche Weise disziplinübergreifend gebündelt“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Volker Epping.
Forschungsprojekte an der LUH
An unterschiedlichen Standorten der LUH laufen viele hochaktuelle Forschungsprojekte. So arbeiten etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste und im Testzentrum Tragstrukturen daran, Offshore-Windenergieanlagen noch standfester zu machen. Nachnutzungsstrategien für alte Windenergieanlagen sind ein weiterer Fokus im Bereich der Windenergieforschung. Schwerpunkte der Solarenergieforschung an der LUH sind die Entwicklung hocheffizienter Solarzellen und die Verringerung von Produktionskosten. In der Luftfahrt von morgen und vielen anderen Bereichen spielt grüner Wasserstoff als sauberer Energieträger eine entscheidende Rolle. Daran und an weiteren Themen des energieeffizienten und nachhaltigen Fliegens wird an der LUH geforscht. Im Bereich Photovoltaik laufen in Kooperation mit dem Institut für Solarforschung in Hameln (ISFH) Forschungsarbeiten zur Integration von Photovoltaik-Anlagen in Gebäudefassaden, die die Nutzung von Dachflächen ergänzen soll.
Technologien zur Energiewandlung und -speicherung
Zudem geht es im Forschungsschwerpunkt darum, Energietransport, -wandlung und -speicherung zu erforschen, besonders mit biologischen, chemischen, mechanischen und thermischen Verfahren. Im Forschungsbau Dynamik der Energiewandlung werden Systeme zur Energieerzeugung erprobt, beispielsweise um Schwankungen bei der Wind- und Solarenergie abfedern zu können. Zur Energiewandlung werden Techniken wie Wärmepumpen und Elektrolyseure eingesetzt, auch zur Kopplung von Energiesektoren wie Strom, Gas und Wärme.
Akzeptanz und gesellschaftlicher Diskurs
All dies ist nur dann erfolgreich, wenn die Wege zur Transformation von allen getragen werden. Dafür werden Aspekte der Akzeptanz erforscht. Beispielsweise wird im Immersive Media Lab die Akustik von Windenergieanlagen reproduziert und simuliert und die Wahrnehmung von Schallimmissionen erforscht. Um den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anzuregen, entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem digitale Planspiele für Bürger-, Verwaltungs-, Politik- und Interessensgruppendialoge.
Vernetzung im Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN)
Die Energieforschung in Niedersachsen vernetzt sich im Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN), einem gemeinsamen wissenschaftlichen Zentrum der Universitäten Hannover, Braunschweig, Clausthal, Göttingen und Oldenburg. Als zentrale Forschungs-, Vernetzungs- und Kommunikationsplattform bündelt es die Energieforschungskompetenzen der Universitätsstandorte und führt die Akteurinnen und Akteure der Transformation des Energiesystems aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammen.
Diese Artikel könnten dich auch interessieren
Die Leibniz Universität Hannover hat einen neuen Forschungsschwerpunkt in der Energieforschung gesetzt. Diese Initiative zielt darauf ab, innovative Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende zu entwickeln. Dabei spielen erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien eine zentrale Rolle. Besonders im Bereich der Photovoltaik werden neue Ansätze erforscht, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen zu verbessern.
Ein wichtiger Aspekt der Energieforschung ist die Integration von Photovoltaikanlagen in Wohngebäuden. Hierbei werden die Photovoltaikanlage Eigenheim Kosten-Nutzen untersucht, um Hausbesitzern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Die Forschung zeigt, dass durch den Einsatz von Solaranlagen nicht nur die Energiekosten gesenkt, sondern auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann.
Ein weiteres spannendes Projekt an der Universität ist die Batterierecycling Kooperation Nigeria Deutschland. Hierbei geht es darum, nachhaltige Lösungen für das Recycling von Batterien zu entwickeln. Diese Kooperation zeigt, wie wichtig internationale Zusammenarbeit in der Energieforschung ist, um globale Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Technologien voranzutreiben.
Auch die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger wird an der Leibniz Universität intensiv erforscht. Das EWE Wasserstoffprojekt Emden ist ein Beispiel dafür, wie Wasserstoff in der Praxis eingesetzt werden kann. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Potenziale von Wasserstoff für die Energieversorgung zu nutzen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Ergebnisse dieser Forschung könnten wegweisend für die zukünftige Energieversorgung sein.

